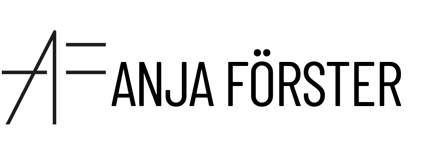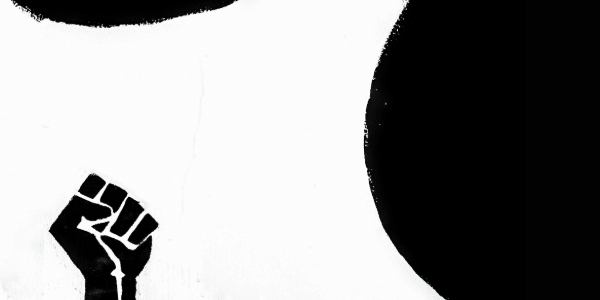Ein Dreamteam: Cody, der überquirlige Radiomoderator aus New York. Wendy, das blonde All-American-Girl aus dem mittleren Westen mit einem ausgeprägten Hang zu Zahlen und Daten. Loren, der wohlbeleibte Mormone aus Utah, der vor seinem Studium für eine Handelsorganisation in Japan und Chile gearbeitet hatte. Und ich, die Deutsche, die sich gerade erst an ein Leben als Studentin in den USA herantastete.
Das war Mitte der 90er Jahre … lange ist es her. Beim MBA-Studium in den USA wird man vom Tag eins an in selbstorganisierte Teamarbeit reingeschubst. Ich machte dabei Erfahrungen in der gesamten Bandbreite der zwischenmenschlichen Beziehungen: vom miserablen Hickhack bis zum sich perfekt ergänzenden Zusammenspiel der Teamplayer. Und obwohl es so lange her ist, kann ich mich noch heute sehr genau an mein allerbestes Team erinnern.
Nur: Warum eigentlich war es so gut?
Eine naheliegende Vermutung wäre, dass die komplementäre Verschiedenheit von Cody, Wendy, Loren und mir den Unterschied ausgemacht hat. Heterogenität als Erfolgsrezept. Aber stimmt das wirklich?
Was eigentlich ist das Geheimnis effektiver Teamwork?
Vier gute Gründe und ein sehr guter Grund
Alphabet, das früher Google hieß, hat sich genau diese Frage gestellt. Bei 61.000 Vollzeitmitarbeitenden sind gute Bedingungen für Teamwork nicht ganz unerheblich.
Mehr als zwei Jahre lang forschte Alphabet darum im Projekt Aristotle nach dem optimalen Teamrezept und analysierte dazu mehr als 180 Teams aus verschiedenen Unternehmensbereichen.
Die gewonnenen Daten wurden mit Hilfe von Algorithmen analysiert, aber zunächst fand sich kein signifikantes Muster. Bildungshintergrund? Intro- oder Extrovertiertheit? Geschlechterverteilung? Nirgendwo stieß man auf Relevantes. Manche erfolgreichen Teams bestanden aus Freunden. Andere, ebenfalls erfolgreiche Teams, setzten sich aus einander kaum bekannten Kollegen zusammen. Schließlich richteten die Forscher ihren Fokus auf die Art, wie Teammitglieder miteinander kommunizierten … und wurden fündig!
Fünf Kriterien filterten sie heraus, die eine zuverlässige Unterscheidung von effektiven und weniger effektiven Teams zuließ. Und eigentlich sind vier davon eher weniger überraschend:
- Zuverlässigkeit: die Teammitglieder erledigen ihre Arbeit pünktlich und weichen ihrer Verantwortung nicht aus.
- Struktur und Übersichtlichkeit: Klarheit über die Erwartungen an den einzelnen und darüber, wie diese Erwartungen zu erfüllen sind und an welchen Zielen das Team arbeitet.
- Sinn: Mitglieder können in ihrer Arbeit selbst und/oder in deren Ergebnis einen Sinn erkennen.
- Wirkung: Es ist für die Teammitglieder klar erkennbar, welchen Beitrag ihre Arbeit zum Erfolg des Unternehmens leistet.
Das wichtigste Kriterium – Sicherheit
Soweit so gut. Aber jetzt wird es interessant: Das fünfte und für die Effektivität laut den Daten mit Abstand wichtigste Kriterium ist:
- Psychologische Sicherheit: Die Teammitglieder fühlen sich im Umgang miteinander sicher. Sie haben keine Befürchtung, bei Nachfragen und Einsprüchen als ignorant, inkompetent oder negativ empfunden zu werden. Sie fühlen sich von den anderen nicht be- oder verurteilt, egal, was sie sagen.
Das ist überraschend! Psychologische Sicherheit als Erfolgsparameter?
Aber bei genauerem Hinsehen, ist es nachvollziehbar: Wenn sich Menschen in Teams sicher sind, dass sie sich frei äußern können, dass sie eine eigene Meinung vertreten können, dass im Team keine Frage oder Idee für dumm gehalten wird, sondern dass jede Äußerung erstmal als konstruktiv wahrgenommen wird, dann halten sie mit ihren Ideen nicht hinterm Berg. Dann legen sie nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Dann haben sie den Mut kreativ zu sein. Dann blühen Teams auf und ihre Leistungsfähigkeit explodiert.
Zonen der Angstfreiheit
Die nächste Frage ist logisch: Wie stellt man Sicherheit her? Sie ist kein Selbstläufer, sondern dafür braucht es zwei entscheidende Zutaten: Vertrauen und die Bereitschaft füreinander einzustehen.
Umgekehrt gilt: Dort, wo Teammitglieder fürchten, bei dem kleinsten Fehler von den anderen als inkompetent angesehen zu werden, wächst kein Vertrauen, sondern es gedeiht Unsicherheit – und die ist extrem unproduktiv. Denn wer mit dem Gefühl der Unsicherheit handelt, der setzt seine ganze Energie zuerst dafür ein, sich selbst zu schützen, statt im Sinne der gemeinschaftlichen Ziele des Teams zu handeln.
Wer in seinem Unternehmen also Teams haben will, die wirklich funktionieren, muss Sicherheitszonen schaffen. Damit meine ich einen sozialen Raum, in dem Respekt und Toleranz zu Hause sind. Ein Ort, an dem die Menschen keine Angst haben und jeden Tag mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, dass ihr Beitrag geschätzt wird. Auf diesem Nährboden können sich Teammitglieder ausprobieren und Erfolge feiern.
Sicherheitszonen sind Führungsaufgabe
Eine Kultur der „Sicherheitszonen“ zu schaffen, das ist Führungsaufgabe!
Zwar können Führungskräfte nicht eine bestimmte Unternehmenskultur erzeugen, aber sie können die Bedingungen fördern, unter denen Vertrauen und die Bereitschaft, füreinander einzustehen, gedeihen. Jedem einzelnen Teammitglied geht es damit besser. Und eben auch – und das ist das wesentliche Ergebnis des Projekts Aristotle – der Organisation als Ganzes!